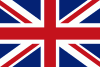Dobrý den, vážené dámy a pánové,
Guten Tag, verehrte Damen und Herren,
Soziale Gerechtigkeit ist ein Thema, das in unseren modernen Gesellschaften auf großes Interesse stößt, zumal in Zeiten von Krisen, in denen das Wachstum einbricht, die Arbeitslosigkeit steigt und die Unterschiede zwischen arm und reich zunehmen. Die Auseinandersetzungen um dieses Thema sind oft von großer moralischer Empörung geprägt. Das ist verständlich, aber nicht immer hilfreich. Denn die moralischen Energien müssen kombiniert werden mit ökonomischem Sachverstand und einem klaren Begriff von sozialer Gerechtigkeit. Sonst besteht die Gefahr, dass im politischen Prozess Entscheidungen getroffen werden, die mittel- oder langfristig der sozialen Gerechtigkeit nicht dienen, sondern ihr möglicherweise sogar schaden.
Der Begriff „Soziale Gerechtigkeit“ entstand im Kontext der Sozialen Frage des 19. Jahrhunderts. Zuerst gebraucht wurde er vom neuscholastischen Jesuitentheologen Luigi Taparelli (1793-1862), der ein material gehaltvolles Naturrecht zu begründen versuchte. Sein Hauptwerk hatte erheblichen Einfluss auf das sozialkatholische Denken in Deutschland. In der im 19. Jahrhundert immer mächtiger werdenden sozialkatholischen Bewegung wurden als Verantwortliche für die Lösung der wachsenden Armutsprobleme zunächst die christlichen Arbeitgeber und die Besitzenden adressiert, von deren Barmherzigkeit man die nötige Umverteilung erwartete. Als sich diese Hoffnung jedoch als falsch erwies, wurden zunehmend gesellschaftliche Strukturen und Institutionen als reformbedürftig angesehen und für deren entsprechende Veränderung der Nationalstaat in die Pflicht genommen. Diesen Lernprozess kann man exemplarisch an der Entwicklung von Bischof Ketteler aufweisen. Heute zeigt sich, dass es bei Fragen der sozialen Gerechtigkeit nicht nur um Armutsbekämpfung gehen kann, weil die Beteiligungsgerechtigkeit in den Vordergrund rückt, und zunehmend übernationale Organisationen tätig werden müssen, um national nicht mehr lösbare Probleme auf europäischer Ebene oder global angehen zu können.
Im Folgenden werde ich nach einer kurzen Erläuterung zur Unverzichtbarkeit einer Praxis der Gerechtigkeit und einem Hinweis zu Aussagen zur sozialen Gerechtigkeit in der kirchlichen Sozialverkündigung ein Panorama aktueller Herausforderungen für soziale Gerechtigkeit zeichnen. Dabei möchte ich besonders auf Europäisierung und Globalisierung und als Beispiele für die europäische Ebene dabei kurz auf das Projekt einer europäischen Arbeitslosenversicherung eingehen und für die globale Ebene ebenfalls sehr kurz Ideen zu einem globalen minimalen Grundeinkommen diskutieren. Daran schließt sich eine Stufentheorie sozialer Gerechtigkeit an, die zugleich verschiedene Aspekte sozialer Gerechtigkeit mit unterschiedlicher Dringlichkeit auszeichnet und helfen soll zu klären, welche Gerechtigkeitsprobleme auf welcher Ebene anzugehen wären.
1. Die Unverzichtbarkeit einer Praxis der Gerechtigkeit für den Christlichen Glauben
Damit ich nicht missverstanden werde: Ich bin der Meinung, dass das Eintreten für soziale Gerechtigkeit beileibe nicht nur eine Sache der Christen ist. In anderen Religionen, insbesondere in Judentum und Islam gibt es ganz ähnliche Gerechtigkeitsvorstellungen. Und auch jemand, der keiner Religion angehört, aber für sich selbst und andere die gleiche Menschenwürde und daraus folgend bestimmte Menschenrechte beansprucht, muss daraus auch Folgerungen für soziale Gerechtigkeit ziehen.
Für Christen gibt es aber sicherlich noch einen besonderen Grund, für soziale Gerechtigkeit einzutreten. Wer nämlich von einem menschenfreundlichen und gerechten Gott Zeugnis geben will, kann dies glaubwürdig nur tun, wenn er selbst tatkräftig für Gerechtigkeit eintritt. Schon die prophetische Kultkritik im Alten Testament fordert, den Armen Gerechtigkeit zu verschaffen, bevor man sich der kultischen Verehrung widmet (z.B. Jes 1,11-17). Jesus stellt sich in diese prophetische Tradition. Nach der Gerichtsrede in Matthäus 25 hängt das ewiges Heil daran, was die Menschen den „geringsten“ der Schwestern oder Brüder Jesu getan oder nicht getan haben (Mt 25, 40.45). Im Magnifikat bringt Maria zum Ausdruck, was die Ankunft des Sohnes Gottes auf Erden bedeutet: „Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen.“ (Lk 1, 52f). Papst Franziskus teilt ganz offensichtlich diese Auffassung und bekräftigt sie in Taten und Worten. In „Evangelii gaudium“ spricht er etwas kompliziert von der „absolute[n] Vorrangigkeit des ‚Aus-sich-Herausgehens auf den Mitmenschen zu‘“ (EG 179). Für den Papst handelt es sich sogar um einen „absoluten Vorrang“. Das heißt: Diese Zuwendung zum Menschen ist wichtiger als alle Moral, als alle Theologie, als jedes Dogma, als jeder religiöse Ritus. Eine christliche Gemeinschaft und die Kirche als Ganze werden, wenn sie diesen Zusammenhang vergessen, leicht „in einer mit religiösen Übungen, unfruchtbaren Versammlungen und leeren Reden heuchlerisch verborgenen spirituellen Weltlichkeit untergehen“ (EG 207). So ist für Christen und christliche Kirchen eigentlich klar: Der Einsatz für Gerechtigkeit muss ihnen ein entscheidendes und vorrangiges Anliegen sein, ja, er wird zum Test für ihre Glaubwürdigkeit.
2. Soziale Gerechtigkeit in der päpstlichen Sozialverkündigung
In meinem Artikel für die tschechische Zeitschrift Socialni prace habe ich einen Überblick über die päpstliche Sozialverkündigung von Rerum novarum bis Evangelii gaudium gegeben und dafür in den Sozialenzykliken gezielt nach Stellen gesucht, an denen von sozialer Gerechtigkeit die Rede war. Ich kann und will das hier nicht en detail referieren. Das Ergebnis, das mich in seiner Eindeutigkeit selbst überrascht hat, will ich Ihnen aber nicht vorenthalten. Folgende Elemente sind entscheidend:
Erstens: Schon Quadragesimo anno spricht neben der „Sittenbesserung“ bereits von der notwendigen „Zuständereform“ (QA 77). Es ist hier bereits ganz klar, dass soziale Gerechtigkeit nicht nur von den Haltungen und der Moralität von einzelnen abhängt, sondern von Institutionen und Strukturen, die dementsprechend gestaltet werden müssen.
Zweitens: Seit Mater et Magistra 1961 sehen wir zudem die Tendenz, dass wirklich „alle Bevölkerungskreise am wachsenden Reichtum der Nation entsprechend beteiligt werden“ müssen (MM 73, vgl. 112) Der Wohlstand einer Gesellschaft darf nicht nur am insgesamt erwirtschafteten Bruttoinlandsprodukt gemessen werden, sondern verlangt eine bessere Verteilung der Güter unter alle Mitglieder der Gesellschaft (MM 74), einschließlich einer breiteren Streuung des Eigentums (MM 113-115).
Ganz neu und für die damalige Zeitsituation ausgesprochen bemerkenswert ist schließlich drittens die Tatsache, dass die „soziale Gerechtigkeit“ in Mater et Magistra explizit bereits auch auf den wirtschaftlichen Ausgleich „zwischen Völkern verschieden hoher Wirtschaftsstufe“ bezogen wird (MM 157ff) und damit eine globale Perspektive eingenommen wird. „Entwicklungshilfe“ wird hier als Teil einer weltweit anzuwendenden „sozialen Gerechtigkeit“ gesehen. Auch die zweite, der weltweiten Realisierung der Menschenrechte und dem Verhältnis von Gerechtigkeit und Frieden gewidmete Sozialenzyklika von Johannes XXIII., Pacem in terris (1963), betrachtet die Beziehungen unter den Staaten unter den Kriterien von Gerechtigkeit und Solidarität (PT 98). Mit dem Recht auf Auswanderung und Einwanderung (PT 25) wird dann konsequenterweise sogar ein aus dieser globalen Solidarität erwachsendes Individualrecht formuliert. In der Konzilskonstitution Gaudium et spes (1965) wird dann endgültig und profiliert eine globale Perspektive eingenommen: „Aus der immer engeren und allmählich die ganze Welt erfassenden gegenseitigen Abhängigkeit ergibt sich als Folge, daß das Gemeinwohl […] heute mehr und mehr einen weltweiten Umfang annimmt und deshalb auch Rechte und Pflichten in sich begreift, die die ganze Menschheit betreffen.“ (GS 26) Die Pastoralkonstitution prangert auch „allzu große wirtschaftliche und gesellschaftliche Ungleichheiten zwischen den Gliedern oder Völkern in der einen Menschheitsfamilie“ an, denn „sie widersprechen der sozialen Gerechtigkeit […].“ (GS 29) Aus der Allgemeinwidmung der Güter an die ganze Menschheit (GS 69,76) ergebe sich zwingend die Forderung von Gerechtigkeit und Liebe „innerhalb der Grenzen einer Nation und im Verhältnis zwischen den Völkern.“ Diese globale Perspektive setzt sich dann in Populorum progressio (1967) fort. Dort heißt es kurz und knapp: „Heute ist – darüber müssen sich alle klar sein – die soziale Frage weltweit geworden.“ (PP 3) Papst Johannes Paul II. hat diese globale Perspektive ungebrochen fortgesetzt und aus der Forderung der globalen Gerechtigkeit heraus den real existierenden Kapitalismus immer scharf kritisiert.
Anders als Papst Benedikt XVI. klingt die Kapitalismuskritik von Papst Franziskus in seinem Rundschreiben Evangelii gaudium (2013) wieder besonders radikal. Sie knüpft an lateinamerikanische Konzepte einer Theologie der Befreiung an. Franziskus beklagt eine „Wirtschaft der Ausschließung und der Disparität der Einkommen“ und behauptet: „Diese Wirtschaft tötet.“ (EG 53) Seiner Meinung nach ist „das gesellschaftliche und wirtschaftliche System an der Wurzel ungerecht“ (EG 59), unter anderem, weil das Geld zum Götzen geworden sei (EG 55). Auffällig ist, dass für Franziskus die Ungerechtigkeit vor allem in der Exklusion und in der Ungleichheit besteht. Dass umgekehrt soziale Gerechtigkeit auch die Integration der bislang Ausgeschlossenen impliziert, ist keine Frage. Aber fordert die Gerechtigkeit anstelle der Ungleichheit wirklich Gleichheit – und wenn ja, Gleichheit von was? Diese Frage muss noch diskutiert werden, genauso wie die seit Franziskus wieder stark ins Bewusstsein getretene Frage der globalen sozialen Gerechtigkeit.
3. Herausforderungen sozialer Gerechtigkeit heute
Schon seit Jahrzehnten ist von einer Krise des Sozialstaates die Rede. Sie manifestiert sich in vielen europäischen Ländern im Problem seiner Finanzierung, die angesichts wirtschaftlicher Krisen, wachsender Staatsverschuldung und des demographischen Wandels in Zukunft noch schwieriger werden wird. Der Bevölkerungsrückgang, verbunden mit einer Zunahme des Anteils der Älteren, die versorgt werden müssen und einer Abnahme des Erwerbspersonenpotenzials destabilisiert insbesondere Altersversorgungssysteme, die auf dem Umlageverfahren beruhen. Bei abnehmenden Geburtenzahlen und steigender Lebenserwartung wird das Verhältnis von Erwerbstätigen und zu versorgenden Älteren immer ungünstiger. Hier gibt es keine Lösung, die nicht mindestens von einer Seite als ungerecht empfunden wird. Sollen nämlich die Rentner in Zukunft genauso hohe Renten bekommen wie die heutigen Rentner, werden die Belastungen der Erwerbstätigen in Zukunft viel höher sein als heute. Sollen umgekehrt diese Belastungen gleichbleiben, werden die Renten erheblich abgesenkt werden müssen. Natürlich kann man versuchen, durch mehr Zuwanderung, eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen, kürzere Ausbildungszeiten und einen späteren Renteneintritt die Probleme zu mildern, aber aus der Welt schaffen wird man sie dadurch nicht. Übrigens gibt es einige empirische Evidenzen für die Annahme, dass in den Gesellschaften, in denen die reale Chancengleichheit von Frauen und Männern schon weiter vorangeschritten ist, die Fertilität der Frauen wieder wächst und auch die Stabilität der Ehen wieder zunimmt, während in Gesellschaften, in denen rechtliche Regelungen, Sozialleistungen, Berufschancen und die Mentalität besonders der Männer sich der Emanzipation der Frauen noch nicht angepasst haben, die Fertilität niedriger ist und die Scheidungsrate höher. Daraus folgt: Will die katholische Kirche, dass wieder mehr Kinder geboren werden und die Ehen stabiler werden, muss sie für eine konsequente Emanzipation der Frau eintreten.
Klar ist jedenfalls: Viele der anstehenden Reformen führen in Dilemmata und zur Verunsicherung mindestens einiger Teile der Bevölkerung, zu Brüchen traditioneller Gewissheiten und Gewohnheiten. Die Folge ist, dass es immer für eine Gruppe Grund zu moralischer Empörung gibt, deshalb führen Reformen oft zur Entsolidarisierung in der Gesellschaft und untergraben damit die Grundlage der Legitimität des sozialen Sicherungssystems.
Ein weiteres Problem liegt darin, dass ein soziales Sicherungssystem einerseits soziale Not tatsächlich lindern muss, gleichzeitig aber keine Anreize dafür schaffen darf, dass sich Menschen in einer Situation einrichten, in der sie durch Sozialleistungen vor extremer Armut bewahrt werden. Es gibt so etwas wie eine Armutsfalle, wenn es in manchen Situationen für Menschen lukrativer ist, von Sozialleistungen zu leben, als sich eine Arbeit zu suchen. Das Fehlen von Eigenverantwortung würde aber sowohl die sozialen Sicherungssystem langfristig überfordern, als auch die Betroffenen dazu verführen, sich selbst aus gesellschaftlichen Beteiligungsmöglichkeiten auszuklinken. So kann soziale Sicherung paradoxerweise zur Exklusion führen.
Der Sozialstaat leidet zumindest bei uns in Deutschland auch unter enormen Effizienzmängeln und fehlender Transparenz. Viele Regelungen sind für den Laien vollkommen undurchschaubar und viel zu kompliziert, sie verursachen dementsprechend bei Unternehmen und in der Verwaltung hohe Kosten. Auch überblickt kaum jemand das Steuerrecht und die Vielzahl unterschiedlicher Abgaben und Sozialleistungen. Je nachdem, wie der Sozialstaat finanziert wird – beispielsweise über hohe Mehrwertsteuersätze – führt dies dazu, dass die Empfänger von Sozialleistungen im Grunde zugleich diejenigen sind, die das System auch finanzieren, so dass das Geld nur von der einen Tasche in die andere fließt – allerdings über den Umweg einer Bürokratie, von deren Kosten natürlich ein Teil des Geldes geschluckt wird. Schließlich passt der Sozialstaat, wie er gegenwärtig besteht, zunehmend weniger zu den heute vorherrschenden individualisierten Lebensläufen, der veränderten familialen Lebensformen und zu den Freiheitsansprüchen mündiger Bürger/innen. Er erzwingt allzu oft Standardlösungen, die zur traditionellen Geschlechterrollendifferenz und zu früheren Normalerwerbsbiografien gepasst haben mögen, aber heute überholt sind.
Probleme gibt es auch zunehmend innerhalb der europäischen Union, in der der gemeinsame Markt, die Arbeitnehmerfreizügigkeit und innerhalb der Eurozone die gemeinsame Währung ein sehr viel stärker aufeinander abgestimmtes wirtschafts- und sozialpolitisches Handeln erforderlich machen. Dass sich dann in der Bewältigung der Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise die einen über Zumutungen einer Sparpolitik moralisch empören, während gleichzeitig die anderen sich darüber aufregen, dass sie das Risiko eingehen sollen, für ärmere Länder einstehen zu müssen, stärkt nicht gerade die europäische Solidarität. Solidarität kann nur erwartet werden, wenn auch die Seite der Hilfsbedürftigen zu Eigenanstrengungen und Reformen bereit ist. Aber grundsätzlich brauchen wir die Einsicht, dass zunehmende ökonomische Integration auch eine wachsende politische und soziale Integration nach sich ziehen muss. Das sieht dann zunächst so aus, als müssten die einzelnen Nationen Souveränität abgeben. Angesichts einer zunehmend globalisierten Weltwirtschaft, die nationalstaatlich ohnehin nicht mehr geregelt werden kann, ist eine stärkere europäische Zusammenarbeit aber die einzige Möglichkeit, um staatliche Souveränität in der Regelung der Wirtschaft wieder zurückzugewinnen. Jede einzelne Nation muss dann akzeptieren, dass sich andere Nationen in die Regelung ihrer Angelegenheiten einmischen dürfen, aber dem steht umgekehrt der große Vorteil gegenüber, dass jede einzelne europäische Nation sich nicht unsteuerbaren wirtschaftlichen Prozessen ausliefern muss, sondern ihrerseits sich einmischen kann und mitreden kann in der Regulierung der gemeinsamen Angelegenheiten. Im Grund ist das das Wesen einer Demokratie in einem Gemeinwesen: ich muss akzeptieren, dass andere auch über mich bestimmen, aber ich gewinne zugleich das Recht, auch über andere zu bestimmen.
Auf dem Weg zu einem sozialeren Europa wird in letzter Zeit zunehmend die Einführung einer Europäische Arbeitslosenversicherung diskutiert, wie sie u. a. vom ungarischen EU-Kommissar Lazlo Andor vorgeschlagen wird. Das würde so funktionieren, dass alle europäischen Arbeitnehmer eine Abgabe in eine europäische Arbeitslosenversicherung einzahlen würden und dann im Falle von Arbeitslosigkeit ein Arbeitslosengeld bekämen, z. B. 40% des früheren Bruttolohns für eine Zeit von 6 Monaten. Den jeweils nationalen Arbeitslosenversicherungen stünde es frei, diesen Betrag aufzustocken oder länger zu zahlen. Derzeit würde beispielsweise Spanien mit seiner hohen Arbeitslosigkeit erheblich von einem solchen System profitieren, während Deutschland mit etwa 5 Milliarden Euro pro Jahr belastet würde. Deshalb gibt es auch bislang aus Deutschland wenig Sympathien für ein solches Projekt, während Italien, Frankreich und natürlich Spanien das interessant finden. Aber es gibt neben den sozialen auch durchaus ökonomische Argumente dafür. Eine solche europäische Arbeitslosenversicherung, vor allem, wenn sie nur Kurzzeitarbeitslose betrifft, könnte nämlich als automatischer Stabilisator für den Ausgleich von unterschiedlichen konjunkturellen Entwicklungen dienen, die ja in einem gemeinsamen Währungsraum durch andere Maßnahmen gar nicht so leicht aufzufangen sind. In einer Konjunkturflaute in einem Land würde dann Kaufkraft in dieses Land fließen und die Nachfrage ankurbeln, während im Falle eines wirtschaftlichen Booms Kaufkraft abgezogen würde. Allerdings bringt diese Idee auch Probleme mit sich. Wenn nämlich die Arbeitslosigkeit nicht konjunkturell, sondern strukturell bedingt ist, z.B. durch einen zu hohen Mindestlohn oder Rigiditäten des Arbeitsmarktes, dann könnte ein solcher Mechanismen die Anreize für nötige Reformen schwächen und die einen Euro-Länder müssten für eine falsche Arbeitsmarktpolitik der anderen Ländern zahlen. Deshalb ist eine europäische Arbeitslosenversicherung eigentlich erst dann sinnvoll, wenn es gleichzeitig zu einer stärkeren wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Integration kommt. Das aber setzt wiederum die Bereitschaft voraus, dass alle Länder ihre Politiken wirklich intensiv aufeinander abstimmen und dabei zu Kompromissen bereit sind.
Noch schlechter als um soziale Gerechtigkeit auf europäischer Ebene ist es aber um die in den kirchlichen Dokumenten offensiv angemahnte soziale Gerechtigkeit zwischen den Völkern bestellt. Die internationale Politik ist immer noch von nationalen Egoismen geprägt, so dass für eine funktionierende Soziale Marktwirtschaft auf Weltebene die nötigen Institutionen der „Global Governance“ fehlen und zu wenig unternommen wird, um die weltweiten Armutsprobleme effizient und effektiv zu lösen. Vom Erreichen der einmal für 2015 gesteckten Millenium-Entwicklungsziele sind wir weit entfernt. Ein Post-2015-Prozess kommt nur mühsam in Gang. Insbesondere wird es nötig werden, auch in den ärmeren Ländern mehr und mehr soziale Sicherungssysteme aufzubauen, beginnend mit der Sicherung des Existenzminimums für alte Menschen, mit der Unterstützung von Familien mit Kindern (bei gleichzeitiger Verpflichtung zum Schulbesuch der Kinder) und mit dem Aufbau einer guten und allen zugänglichen Gesundheitsversorgung. Damit dies in allen Ländern möglich wird und einzelne Länder auch in Krisensituationen zuverlässig aufgefangen werden, braucht es mindestens eine Art globale soziale Rückversicherung der nationalen sozialen Sicherungssysteme.
Eine Idee, die derzeit in der Entwicklungspolitik diskutiert wird und die ich für die globale Ebene als Beispiel vorstellen möchte, ist die Idee eines globalen, für alle Menschen einheitlichen, bedingungslosen Grundeinkommens. Nähere Informationen dazu findet man etwa auf www.globalincome.org. Auf den ersten Blick klingt diese Idee vielleicht etwas eigenartig, aber sie ist einer genaueren Betrachtung würdig. Der Vorschlag ist, jedem Menschen auf dieser Erde ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1 US-$ pro Tag auszuzahlen, natürlich in monatlichen Raten. In Anbetracht der Tatsache, dass etwa 1 Milliarde Menschen mit weniger als einem US-$ und 2,5 Milliarden mit weniger als 2 US-$ pro Tag auskommen müssen, ist klar, dass ein solches Grundeinkommen die Situation des ärmsten Drittels der Weltbevölkerung erheblich verbessern würde. In einem Dorf in Namibia wurde etwas Ähnliches vor einigen Jahren tatsächlich einmal ausprobiert. Man hat festgestellt, dass es den Menschen dadurch wirklich besser ging, dass mehr Kinder in die Schulen geschickt wurden, dass mehr Menschen unternehmerisch tätig geworden sind und dass die Menschen mehr für ihre Gesundheit tun konnten. Die Zahlung eines Grundeinkommens, das in diesem Experiment sogar nur 10 Euro pro Monat betrug, hatte also durchaus überwiegend positive Effekte. Bei den reicheren zwei Drittel der Menschheit könnte man die Auszahlung eines solch niedrigen Grundeinkommens kostenneutral gestalten, indem dann eben Sozialleistungen entsprechend geringfügig gesenkt oder Steuern oder Abgaben entsprechend geringfügig angehoben würden. Für eine grobe Berechnung der Kosten wäre es deshalb ausreichend, die zusätzlich zu zahlenden Grundeinkommen von einem US-$ am Tag für die ärmsten 2,5 Milliarden Menschen zu veranschlagen. Das wären Kosten von ziemlich genau einer Billion Dollar pro Jahr. Das klingt zunächst viel, ist aber wesentlich weniger als die 1,75 Billionen Dollar, die jährlich für Rüstung ausgegeben werden. 1 Billion Dollar, das ist etwas mehr als 1% des Weltbruttosozialprodukts, also ein Betrag, den man eigentlich aufbringen können müsste, um Hunger und Elend so vieler Menschen dauerhaft zu beseitigen. Ein entsprechender Weltfond könnte gefüllt werden durch Abgaben der verschiedenen Nationen in Abhängigkeit von ihrem Bruttoinlandsprodukt oder durch neue globale Steuern wie etwa eine globale Finanztransaktionssteuer oder eine globale CO2-Steuer. Beide hätten sogar noch andere positive Effekte, nämlich auf die Finanzmärkte bzw. auf das Weltklima.
Ob ein solches Modell eines globalen Grundeinkommens realisiert wird, entscheidet sich neben der Lösung der technischen und organisatorischen Schwierigkeiten vor allem daran, ob der politische Wille dazu aufgebaut werden kann, was letztlich von der Bereitschaft der Menschen in den reicheren Ländern abhängt, für das Schicksal der Armen der Welt Verantwortung zu übernehmen. Dazu müsste deutlich gemacht werden, dass die weltweite Armutssituation allen erhebliche moralische Pflichten auferlegt, denen sie sich eigentlich nicht guten Gewissens entziehen können. Ich würde hier aber zunächst so argumentieren, dass eine positive Entwicklung überall auf der Welt auch im Interesse der reichen Länder liegt. Denn nur bei einer weltweit positiven Entwicklung wird es möglich, Terrorismus effektiv zu bekämpfen, überbordende Migration zu mindern, die ökologischen Probleme anzugehen, insbesondere den Klimawandel zu bremsen und seine Folgen abzufedern sowie ein erwünschtes Maß an globaler Freiheit der Kommunikation, des Reisens und des Handels zu erreichen und zu bewahren. Eine solche, im Interesse aller liegende Kooperation zugunsten der gemeinsamen Güter der Menschheit wird aber nur dann erreicht werden können, wenn die dadurch entstehenden Vor- und Nachteile auch fair unter den Nationen aufgeteilt werden, was sicherlich bedeutet, dass die entwickelteren Länder eine größere Last zu tragen haben.
Im Folgenden letzten Abschnitt will ich nun versuchen, ein systematisches Grundkonzept sozialer Gerechtigkeit vorzulegen, das helfen soll, die verschiedenen Gerechtigkeitsprobleme und die verschiedenen Ebenen ihrer Realisierung besser differenzieren zu können.
4. Ein Stufenkonzept sozialer Gerechtigkeit
Seit Beginn dieses Jahrhunderts ist ein eindeutiger Trend feststellbar, der freilich zugleich kontrovers diskutiert wird. Unter Gerechtigkeit wird sehr viel weniger die Gleichheit von Verteilungsergebnissen verstanden, sondern die Gleichheit in den Startpositionen und den Chancen, durch eigene Leistung Erfolg zu haben. Übrigens gilt das auch für kirchliche Stellungnahmen, z.B. für den Impulstext „Das Soziale neu denken“ der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen unter Bischof Josef Homeyer aus dem Jahr 2003 oder den Impulstext „Chancengerechte Gesellschaft“ der gleichen Kommission unter Reinhard Kardinal Marx aus dem Jahr 2011.
Damit die Menschen überhaupt bereit werden, sich mit den Reformen intensiv auseinanderzusetzen und sie sach- und problemorientiert zu diskutieren, bedarf es neben einer breiten öffentlichen Verständigung darüber, wie ernst die Lage tatsächlich ist, einer größeren Klarheit hinsichtlich der Frage, was unter „Sozialer Gerechtigkeit“ zu verstehen sei. Sonst besteht bei der Berufung auf die Forderung nach Gerechtigkeit immer wieder der Verdacht einer bloßen moralischen Überhöhung von Eigeninteressen. Dabei scheint es mir sinnvoll zu sein, den nötigen sozialen Ausgleich in mehreren aufeinander aufbauenden Stufen zu denken.
Ich lasse mich dabei inspirieren von John Rawls und seinem bekannten Gedankenexperiment. Seinem Vorschlag entsprechend sollen wir uns vorstellen, eine Nation würde in einer großen Versammlung die Prinzipien ihres späteren Zusammenlebens gemeinsam festlegen, wobei, und das ist wesentlich, alle Mitglieder der Versammlung unter einem Schleier des Nichtwissens stehen, das heißt, nicht wissen, wer genau sie in dieser späteren Gesellschaft sein werden. Das führt dazu, dass sich alle zwangsläufig in alle möglichen späteren Positionen hineinversetzen, um zu prüfen, ob die gemachten Vorschläge solcher Prinzipien für sie akzeptabel wären. Auf diese Weise, so der Grundgedanke von Rawls, kommt man zu Ergebnissen, die ohne Ansehen einzelner Personen, ohne die Berücksichtigung von irgendwelchen besonderen Interessen zustande kommen und deshalb wirklich einen moralischen Standpunkt widerspiegeln.
4.1 Erste Stufe: Sicherung eines soziokulturellen Minimums
Weil wir einander als moralische Personen und Mitbürger/innen eines demokratischen Gemeinwesens anerkennen, müssen wir uns zunächst wechselseitig mit gleichen Freiheitsrechten ausstatten. Freiheit und Gerechtigkeit stehen also nicht gegeneinander, vielmehr ist die Gleichheit in der Verteilung von Freiheitsrechten ein zentraler Aspekt von Gerechtigkeit. Weil die Wahrnehmung von Freiheitsrechten aber mindestens voraussetzt, dass man genug zum Leben hat, folgt daraus für die soziale Gerechtigkeit, alle Mitglieder einer Gesellschaft mit demjenigen Minimum an Gütern ausstatten, das erforderlich ist, um an diesem Gemeinwesens als Gleichberechtigte beteiligt sein zu können. Diese bedarfsbezogene Rechtfertigung einer Verteilung geht über das rein biologische Existenzminimum hinaus. Das soziokulturelle Minimum umfasst die Ausstattung mit Gütern, die notwendig sind, um „öffentlich anerkannte Bedürfnisse“ zu befriedigen, die von allen vernünftigerweise als grundlegend für ein menschenwürdiges Leben betrachtet würden. Damit sind Pflichten begründet gegenüber all jenen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft erarbeiten können, vor allem sogenannte „Marktpassive“ wie Kinder, Kranke und alte Menschen, aber auch gegenüber denjenigen, denen der Zugang zum Arbeitsmarkt aus welchen Gründen auch immer versperrt ist. Praktisch bedeutet diese Forderung nach einem soziokulturellen Existenzminimum, die sozialen Sicherungssysteme armutsfest zu machen. Es ist klar: In der Rawls’schen Urzustandsversammlung unter dem Schleier des Nichtwissens würde eine freie Marktwirtschaft nur akzeptiert, wenn mindestens eine solche Grundsicherung bereitgestellt würde, damit die Menschen nicht einfach den Risiken des Marktes schutzlos ausgeliefert sind. Ethisch zu rechtfertigen ist also nicht ein „Markt pur“, sondern nur eine „Soziale Marktwirtschaft“.
4.2. Zweite Stufe: Faire Chancengleichheit
Berücksichtigt man zusätzlich, dass die Bürger/innen eines Gemeinwesens einen erheblichen Teil ihrer Selbstachtung aus ihrer aktiven Beteiligung an ihrem Gemeinwesen beziehen, dann reicht eine bloße materielle Alimentierung nicht aus, sondern es kommt dann, wie Amartya Sen hervorgehoben hat, insbesondere auf die „realen Chancen“ an. Es kommt darauf an, dass alle Bürger/innen über Ressourcen verfügen und Fähigkeiten entwickeln können, formal bestehende Chancen auch tatsächlich zu nutzen. Aus diesem Grund ist in den letzten Jahren in der sozialethischen Diskussion der Begriff der „Beteiligungsgerechtigkeit“ in den Mittelpunkt gerückt. Dies betrifft vor allem zwei Problembereiche: Es widerspricht der wechselseitigen Anerkennung als Bürger/innen, wenn wir diesen auf längere Zeit und ohne Aussicht auf Besserung den Zugang zum Arbeitsmarkt versperren und ihnen dadurch die Möglichkeit nehmen, selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Weil Arbeitslosigkeit ein wirklich massives soziales Übel darstellt, ist es notwendig, die Zugänge zum Arbeitsmarkt auch dann zu erleichtern, wenn dies auf Kosten der Arbeitsplatzbesitzer geht. Das Sozialwort der beiden großen deutschen Kirchen von 1997 hat deshalb von einem „Menschenrecht auf Arbeit“ gesprochen, jedenfalls solange „die Erwerbsarbeit für die meisten Menschen den bei weitem wichtigsten Zugang zu eigener Lebensvorsorge und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben schafft“.
Die Forderung nach Chancengleichheit betrifft aber besonders Kinder und Jugendliche. Es gibt keinen Grund dafür, dass Kinder aus unteren Schichten, insbesondere aus Migrantenfamilien, in ihren Startchancen durch ihre Herkunft beeinträchtigt bleiben. Chancengleichheit verlangt deshalb Umverteilung zugunsten der Verbesserung der Chancen der Benachteiligten. Chancengleichheit ist auch ökonomisch sinnvoll. Gesamtgesellschaftlich ist es nämlich höchst nachteilig, wenn Arbeitskräftepotenziale und ohne Chancengleichheit unentdeckt bleibende Begabungen von Kindern aus weniger gebildeten Elternhäusern ungenutzt bleiben. Die wichtigste Institution zur Förderung von Chancengerechtigkeit ist das Bildungssystem. Hier gibt es enorme Gerechtigkeitsprobleme. So ist es beispielsweise nicht einzusehen, dass im Bereich von Kindertagesstätten und Kindergärten, in denen grundlegende soziale und kognitive Fähigkeiten eingeübt werden, eine soziale Selektion stattfindet, weil hier Gebühren verlangt werden, die manche Eltern nicht zahlen können und in vielen Regionen außerdem zu wenig Plätze vorhanden sind.
4.3 Dritte Stufe: Leistungsgerechtigkeit
Ein weiteres Kriterium für eine gerechte Verteilung könnte neben der Bedarfs- und der Chancengerechtigkeit die Leistungsgerechtigkeit sein. Und in der Tat sind unsere Intuitionen in dieser Hinsicht sehr stark, wie dies auch die empirische Gerechtigkeitsforschung nachgewiesen hat. Wir empfinden es in der Regel als gerecht, dass derjenige mehr bekommt, der mehr leistet. Zugleich ist freilich klar, dass Leistungsgerechtigkeit nur dann legitim ist, wenn zuvor faire Chancengerechtigkeit gewährleistet ist. Das Prinzip Leistungsgerechtigkeit ist jedoch nicht so überzeugend wie es scheint. Denn erstens ist es ausgesprochen schwierig zu messen, welchen Beitrag die Einzelnen zu einem kooperativ erzielten Ergebnis beigesteuert haben. Außerdem gibt es das Problem, wie damit umzugehen ist, dass die Kooperationspartner möglicherweise nur zu sehr unterschiedlichen Beiträgen fähig sind. Steht denen, die nur zu weniger in der Lage sind, dann auch nur ein geringerer Anteil am Ertrag zu oder ist denen, die mehr leisten können, ein Mehrertrag moralisch zuzurechnen? Haben sie ihn wirklich „verdient“? In welchem Verhältnis stehen Verdienst nach objektiver und Verdienst nach subjektiver Leistung? Die Realisierung von Leistungsgerechtigkeit über Marktprozesse führt zu weiteren Problemen, hängen doch Marktpreise gerade nicht von der Leistung, sondern von Angebot und Nachfrage ab – wenn der Wettbewerb überhaupt funktioniert, was ja auch nicht immer der Fall ist. Doch hat diese Einsicht nicht zur Konsequenz, auf leistungsbezogene Anreize ganz zu verzichten. Denn im Sinne einer auf freiwilligen und einigermaßen fairen Vereinbarungen beruhenden, „abgeleiteten“ Leistungsgerechtigkeit können Anreizsysteme gerechtfertigt werden, wenn sich zeigen lässt, dass sie von allgemeinem Nutzen sind. Das setzt aber eine Verständigung darüber voraus, welches Maß an Ungleichheit zugunsten des Funktionierens von Anreizen akzeptabel ist.
4.4 Vierte Stufe: Differenzprinzip
Wenn in einem Gemeinwesen alle mit dem sozialen Minimum ausgestattet sind und in den Genuss fairer Chancengleichheit kommen und es darüber hinaus noch etwas zu verteilen gibt, stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien diese Verteilung erfolgen soll und welche Anreize für Leistung demnach installiert werden dürfen. Das berühmte Differenzprinzip nach John Rawls besagt nun, dass Ungleichheiten insoweit legitim sind, als es unter der Voraussetzung dieser Ungleichheit den Ärmsten einer Gesellschaft besser geht als unter der Voraussetzung geringerer Ungleichheit. Notwendige Hintergrundannahme ist, dass gesellschaftliche Kooperationen in der Regel keine Nullsummenspiele sind, sondern meist Win-win-Situationen, weil durch die Besserstellung der einen Anreize geschaffen werden, die wirtschaftliches Wachstum und höhere Produktivität auslösen, so dass auch die anderen besser gestellt werden können.
Geht man vom Rawls’schen Gedankenexperiment aus, so ist leicht einzusehen, dass Ungleichheiten so lange gerechtfertigt und im Urzustand akzeptiert werden, solange auch die am wenigsten Begünstigten von ihr noch einen Nutzen haben. Solange nicht Ungleichheit an sich abgelehnt wird, werden alle im Urzustand Versammelten einer Verbesserung der Situation der Ärmsten zustimmen, auch wenn dies mit einer noch größeren Verbesserung der Situation der Reichsten verbunden ist. Sie werden ihre Zustimmung ab dem Punkt verweigern - nennen wir ihn den D-Punkt -, an dem eine Besserstellung der Reichen für die Armen ohne Auswirkung bleibt oder sie sogar schlechter stellt als vorher. Jeder im Urzustand möchte ja, dass es ihm später möglichst gut geht, auch wenn ihn die schlechteste Position in der späteren Gesellschaft trifft. Es stellt sich nun natürlich die Frage, ob wir uns in den entwickelten Gesellschaften in Europa links oder rechts vom D-Punkt befinden. Muss derzeit die Ungleichheit noch gesteigert werden, weil dies den am wenigsten Begünstigten noch zugute kommt? Oder geht die Ungleichheit bereits weit über das Maß hinaus, das noch nach dem Differenzprinzip gerechtfertigt werden kann? Möglicherweise haben sich durch die neuen Herausforderungen des Sozialstaates, z.B. durch den demographischen Wandel und die Globalisierung die Bedingungen so verändert, dass sich der D-Punkt inzwischen verlagert hat. Durch Globalisierung, demographischen Wandel und Individualisierung der Lebensformen kann sich die Zuordnung zwischen der höchstmöglichen Güterproduktion und einem bestimmten Maß an Ungleichheit so verschoben haben, dass heute höhere Anreize notwendig sind, um den gleichen Güterausstoß und einen ähnlichen Anteil für die am wenigsten Begünstigten zu erreichen. Sollte dies der Fall sein, müsste man die Situation der am wenigsten Begünstigten nicht durch mehr, sondern durch weniger Umverteilung langfristig verbessern. Bei der dann anstehenden Reduktion von sozialen Transferleistungen darf jedoch das soziokulturelle Minimum nicht beeinträchtigt werden. Die weiterhin nötige Umverteilung muss zudem so gestaltet werden, dass nicht nur bestimmte Gruppen, sondern alle Gruppen der Gesellschaft entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit daran beteiligt werden. Das heißt unter anderem, dass Umverteilung in erster Linie Sache des Steuersystems und nicht der Sozialversicherungen sein sollte, denn im Sozialversicherungssystem sind nur die abhängig Beschäftigten beteiligt und durch Beitragsbemessungsgrenzen werden die Bessergestellten immer nur unterproportional herangezogen.
Diese Überlegungen lassen sich nun auch auf die globale Dimension sozialer Gerechtigkeit anwenden. Unstrittig ist sicherlich, dass das Recht auf ein soziokulturelles Existenzminimum allen Menschen zusteht. Das würde jedenfalls für die Einführung eines globalen Grundeinkommens sprechen. Schwieriger zu beantworten ist schon die Frage, wer für dessen Finanzierung zuständig ist. Zunächst sind hier sicherlich die jeweiligen Nationalstaaten verantwortlich. Wenn diese aber versagen oder nicht über ausreichend Mittel verfügen, müssen mehr und mehr die internationale Gemeinschaft und hier besonders die wohlhabenderen Länder Verantwortung übernehmen. Auf jeden Fall ist die Etablierung eines solchen Grundsicherungsniveaus für alle Menschen eine vordringliche Aufgabe.
Auch das Recht auf faire Chancen steht allen Menschen zu. Vor diesem Hintergrund sind die bestehenden Staatsgrenzen und die massive Abwehrpolitik gegen Migranten höchst problematisch. Auch müsste im Bereich des Welthandels noch viel mehr dafür getan werden, dass überhaupt von einem fairen Handel gesprochen werden kann. Ob das Differenzprinzip, das über ein Grundeinkommen und die Chancengerechtigkeit hinausgehende Forderungen implizieren würde, auch global gilt, ist sogar unter den Schülern von Rawls umstritten. Er selbst hatte eine globale Anwendung dieses Prinzips abgelehnt. Aber angesichts der zunehmenden Globalisierung steht sein Argument fehlender Verflechtung und Kooperation auf tönernen Füßen. Eine globale Anwendung des Differenzprinzips würde jedoch entwicklungspolitische Maßnahmen erfordern, die sowohl an Quantität als auch an Qualität weit über die bisherige Politik hinausgehen. Denn die Behauptung, die Reichen müssten, global betrachtet, noch reicher werden, um die Armen besserzustellen, erscheint angesichts der Weltarmuts- und Welthungerprobleme als absurd und zynisch.
5. Schluss
Ethische Reflexionen und Argumente können zur Korrektur bisheriger Überzeugungen und Einstellungen führen, aber sie garantieren nicht, dass dies auch Konsequenzen für das Handeln der Einzelnen hat, und noch viel weniger, dass sich so begründete Forderungen auch politisch durchsetzen lassen. Deshalb ist es wichtig, vernünftige, auch durchaus auf wohlverstandenen Eigeninteressen gegründete Allianzen zu bilden und nach „Win-win“-Situationen zu suchen, um möglichst viele zu einer Kooperation zu bewegen. Trotzdem wird es für die erforderlichen politischen Initiativen immer auch Menschen geben müssen, die aus uneigennütziger Solidarität motiviert sind. Papst Johannes Paul II. hatte sehr wohl Recht, als er meinte, es bedürfe „immer neuer Bewegungen von Solidarität der Arbeitenden und mit den Arbeitenden. Diese Solidarität muß immer dort zur Stelle sein, wo es die soziale Herabwürdigung des Subjekts der Arbeit, die Ausbeutung der Arbeitnehmer und die wachsenden Zonen von Elend und sogar Hunger erfordern.“ Und hier sah er sogar auch eine zentrale Aufgabe der Kirche: „Die Kirche setzt sich in diesem Anliegen kraftvoll ein, weil sie es als ihre Sendung und ihren Dienst, als Prüfstein ihrer Treue zu Christus betrachtet, um so wirklich die »Kirche der Armen« zu sein.“ (LE 8) Nach dem jüngsten Päpstlichen Mahnschreiben Evangelii gaudium zu urteilen, haben wir derzeit einen Papst, der dies genauso sieht und genauso wichtig nimmt. Und das müsste doch eigentlich uns alle motivieren, mehr für soziale Gerechtigkeit auf nationaler, europäischer und globaler Ebene einzutreten.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen.